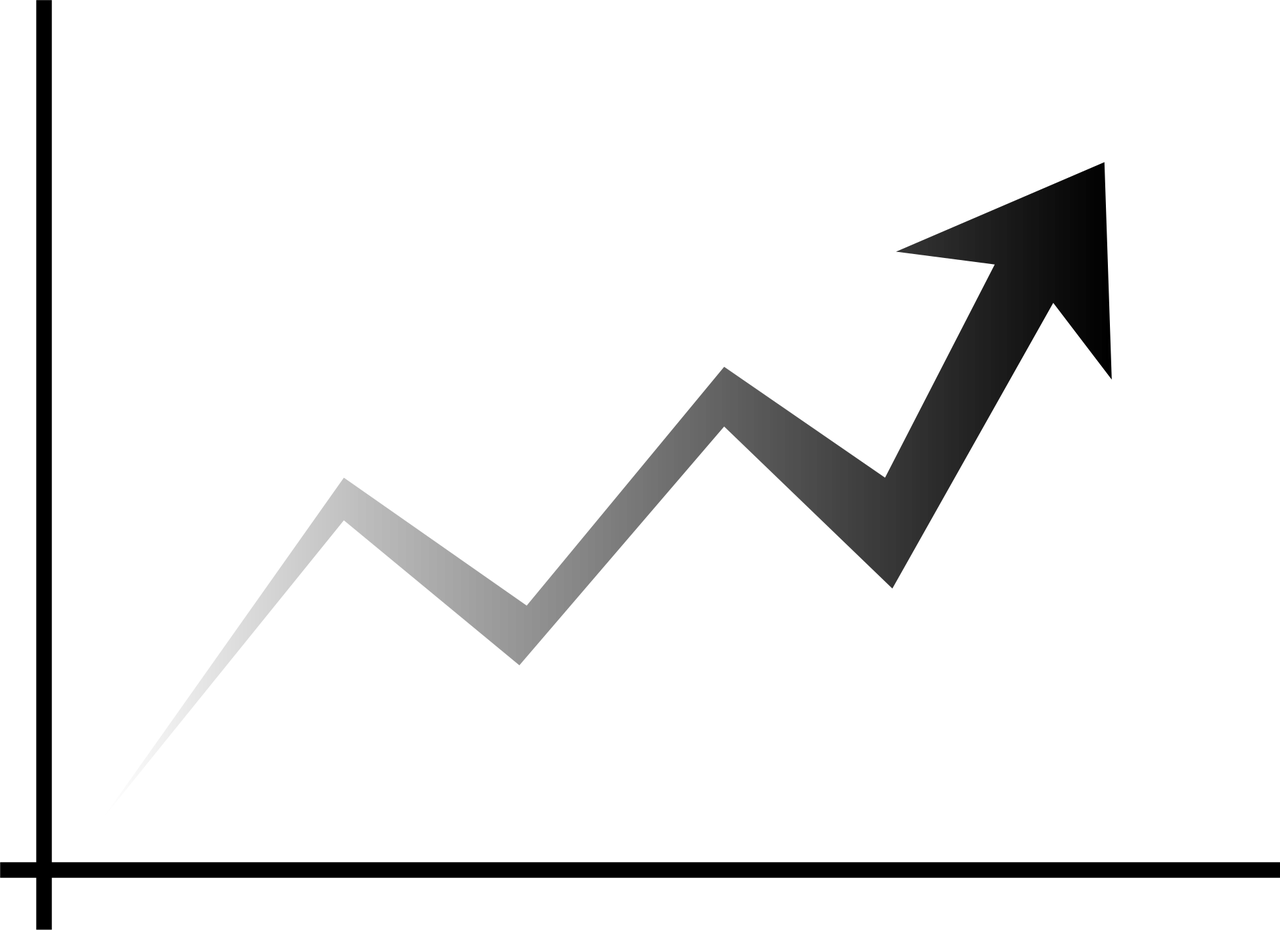In der heutigen Finanzwelt steht der Kunde häufig vor der Herausforderung, aus einer Vielzahl von Produkten die besten auszuwählen, um sein Vermögen optimal zu verwalten. Doch immer mehr Studien und Berichte offenbaren eine besorgniserregende Praxis bei vielen Banken: Anstatt den Kunden die besten, kosteneffizienten und renditestarken Finanzprodukte anzubieten, werden vermehrt bankeigene Produkte mit oft schlechterer Performance und höheren Gebühren verkauft. Besonders im Umfeld großer Finanzinstitute wie der Deutschen Bank, Commerzbank, Unicredit Bank, DZ Bank, KfW Bank, Volksbank, Sparkasse, ING-DiBa, Targobank und Postbank zeigt sich ein Trend, der den Anlegern erheblichen Schaden zufügen kann. Die zugrundeliegende Motivation der Banken ist häufig ein doppeltes Geschäftsmodell, das vor allem auf höhere Erträge für die führenden Institute abzielt – und nicht auf den finanziellen Erfolg ihrer Kunden. Ein weit verbreiteter Interessenkonflikt, mangelnde Transparenz und strenge Regulierungen tragen dabei zur komplexen und undurchsichtigen Situation bei, die Kundendepots immer wieder mit den „schlechtesten“ Produkten füllt.
Diese Praxis ist jedoch kein bloßes Versehen oder ein kurzfristiger Trend, sondern Bestandteil einer systematischen Strategie, die durch Studien des VZ Vermögenszentrums und Gerichtsurteile untermauert wird. Während diverse Banken wie Volksbanken und Sparkassen sich traditionell als Kundenpartner präsentieren, zeigen sich in der Realität häufig Anreize, die zur Platzierung hauseigener, weniger vorteilhafter Fonds und strukturierter Produkte führen. Im Folgenden finden Sie eine ausführliche Analyse über die Beweggründe, Mechanismen und Konsequenzen dieses Phänomens sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf die Kundendepots im Jahr 2025.
Bankeigene Produkte als finanzielle Goldgrube: Warum Institute auf diese Strategie setzen
Die Bankenlandschaft in Deutschland und der Schweiz ist geprägt von einem starken Wettbewerb und sich wandelnden Ertragsmodellen. Seit dem Wegfall von Retrozessionen per Bundesgerichtsentscheid im Jahr 2012 können Banken diese Provisionen nicht mehr ohne Weiteres behalten, sondern müssten sie eigentlich an die Kunden weiterleiten. Das führte zu einem spürbaren Einkommensverlust bei Instituten wie der Deutschen Bank, Commerzbank und der KfW Bank, die traditionell stark von solchen Zahlungen profitiert hatten.
Um diese Ertragslücke zu schließen, setzen die Institute zunehmend auf den Verkauf eigener Produkte. Eine Studie des VZ Vermögenszentrums zeigt, dass seit 2016 ein signifikanter Anstieg des Anteils bankeigener Fonds und strukturierter Produkte in Kundendepots zu verzeichnen ist. Bis 2019 betrug der Anteil dieser hauseigenen Produkte mehr als ein Drittel aller Anlagen in diesen Depots – Tendenz steigend.
Dieser Trend erklärt sich durch den einfachen Anreiz, doppelt zu verdienen: Zum einen kassieren Banken Depotgebühren für die Verwahrung des Vermögens. Zum anderen erzielen sie Produktgebühren aus dem Vertrieb und Management ihrer eigenen Fonds oder strukturierten Wertpapiere. Daher versuchen Institute wie die Volksbank oder Targobank aktiv, den Anteil solcher Produkte im Depot zu erhöhen, um ihre Ertragskraft zu verbessern.
Liste der wichtigsten Gründe, warum Banken auf eigene Produkte setzen
- Umsatzsteigerung durch doppelte Gebühren: Depotgebühren plus Produktgebühren erhöhen den Gewinn signifikant.
- Ertragsverluste durch Regulierung: Wegfall von Retrozessionen zwingt zur Kompensation durch Produktplatzierung.
- Kontrolle über Produktangebot: Eigene Produkte können leicht angepasst und beworben werden.
- Kundenbindungsstrategie: Bankeigene Produkte schaffen Abhängigkeiten und erschweren Depotwechsel.
- Markenstärkung: Eigene Fonds steigern das Ansehen und die Wahrnehmung der Bank als Investment-Anbieter.
| Bank | Anteil bankeigener Produkte (2019) | Ertragsquelle | Hauptmotivation |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 38% | Depotgebühren, Produktgebühren | Ertragssteigerung, Portfolio-Kontrolle |
| Commerzbank | 35% | Produktgebühren, Emissionskosten | Wettbewerbsvorteil |
| Unicredit Bank | 32% | Vertrieb eigener Fonds | Kundenbindung |
| Volksbank | 40% | Depotgebühren, Fondsmanagement | Lokale Marktstellung |
| Sparkasse | 37% | Produktmanagement, Gebühren | Regionale Kundenbindung |

Negative Auswirkungen für Anleger: Wie sich bankeigene Produkte auf die Rendite auswirken
Die Konzentration von bankeigenen Produkten in den Depots der Kunden ist kein harmloser Trend, sondern führt nachweislich zu schlechteren finanziellen Ergebnissen. Studien des VZ Vermögenszentrums belegen, dass die Renditen bei einem höheren Anteil hauseigener Fonds deutlich hinter denen vergleichbarer Indizes oder externer Produkte zurückbleiben. Kunden von Instituten wie der ING-DiBa, Postbank oder DZ Bank sehen sich mit erheblichen Renditeeinbußen konfrontiert, die oft mehrere Prozentpunkte ausmachen.
Dies rührt daher, dass bankeigene Produkte häufig „Mittelklasse“-Anlagen sind. Sie können nicht mit spezialisierten oder kosteneffizienten ETFs und Indexfonds konkurrieren, die breiter diversifiziert sind und niedrigere Verwaltungskosten besitzen. In der Praxis bedeutet dies, dass Investoren mit großen Anteilen an solchen Produkten weniger Kapitalerträge erzielen.
Liste typischer Nachteile bankeigener Produkte für Kunden
- Hohe Gebühren führen zu geschmälerten Nettorenditen.
- Begrenzte Diversifikation durch Konzentration auf Bankprodukte.
- Interessenkonflikte, da Banken eigene Produkte bevorzugen.
- Niedrigere Performance im Vergleich zu Marktbenchmarks wie MSCI World.
- Mangelnde Transparenz bei Kosten und Strategie.
| Depotanteil bankeigene Produkte | Durchschnittliche Rendite gegenüber MSCI World | Anzahl betroffener Depots (Studie 2019) | Durchschnittliche Renditedifferenz (%) |
|---|---|---|---|
| 60,9% | -10% und mehr | 16 | -12,4% |
| 59,2% | zwischen -5% und -10% | 33 | -7,8% |
| unter 30% | nahe MSCI Benchmark | 126 | -1,4% |
Dies bedeutet für Anleger in der Praxis oft, dass ein Portfolio mit hohem Anteil an bankeigenen Produkten mehrere Tausend Euro an entgangener Rendite kosten kann – jährlich. Vor allem Kunden mittelständischer Banken wie DZ Bank und Targobank fällt es schwer, alternative günstigere und leistungsstärkere Produkte empfohlen zu bekommen.
Interessenkonflikte und mangelnde Transparenz: Wie Banken Kundenservice oft sabotieren
Ein zentrales Problem bei der Ausweitung des Verkaufs bankeigener Produkte sind die Interessenkonflikte, die dadurch entstehen. Berater und Vermögensverwalter, die bei Institutionen wie der Commerzbank oder Sparkasse angestellt sind, stehen häufig vor der Wahl: Sie sollen im Sinne des Kunden handeln, doch durch Provisionen und interne Vorgaben auch das eigene Produktportfolio platzieren. Dies führt dazu, dass Beratung nicht mehr unabhängig ist.
Verbraucherbefragungen weisen darauf hin, dass bis zu 43 Prozent der Anleger vermuten, ihre Berater würden Produkte empfehlen, von denen sie selbst finanziell am meisten profitieren. Die Unabhängigkeit der Beratung wird dadurch stark infrage gestellt, was das Vertrauen in Banken wie die Deutsche Bank oder ING-DiBa erheblich schwächt.
Liste der Herausforderungen beim Kundenservice durch Interessenkonflikte
- Bevorzugung bankeigener Produkte trotz besserer Alternativen.
- Intransparente Kostenstruktur erschwert Vergleichbarkeit.
- Druck auf Berater durch interne Vertriebsziele.
- Geringe Offenlegung von Provisionen gegenüber Kunden.
- Vertragsbedingungen erschweren Depotwechsel.
| Thema | Auswirkung | Betroffene Bankgruppen |
|---|---|---|
| Interessenkonflikt | Verringerte Beratungsgüte | Deutsche Bank, Commerzbank, Sparkasse |
| Intransparente Gebühren | Unzufriedenheit, Renditeverluste | Volksbank, Postbank |
| Druck auf Berater | Sales-Orientierung vor Kundeninteresse | ING-DiBa, Targobank |
Um dem entgegenzuwirken, fordern Experten eine strengere Regulierung, mehr Transparenz für Kunden und unabhängige Beratungskonzepte oder sogar den vermehrten Einsatz digitaler Vermögensverwalter, die frei von solchen Interessenkonflikten agieren.
Langfristige Folgen für Kunden und Banken: Verlust von Vertrauen und Marktanteilen
Der anhaltende Trend, bankeigene, oft schlechtere Produkte zu verkaufen, führt nicht nur zu direkten finanziellen Nachteilen für die Anleger, sondern hat auch weitreichende Folgen für die gesamte Finanzbranche. Verbraucher verlieren zunehmend das Vertrauen in Banken wie die Deutsche Bank oder die Commerzbank, wenn sich herausstellt, dass ihre Interessen nicht an erster Stelle stehen. Dies verursacht eine verstärkte Abwanderung zu unabhängigen Vermögensverwaltern und FinTechs.
Banken wie die DZ Bank oder KfW Bank spüren bereits heute, wie Kunden neue Wege suchen, ihr Vermögen jenseits klassischer Produkte zu investieren. Zudem können negative Erfahrungen in Bezug auf bankeigene Produkte zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen, da immer mehr Anleger gegen hohe Gebühren und mangelnde Performance klagen.
Liste potentieller langfristiger Konsequenzen für Banken und Kunden
- Kundenabwanderung zu unabhängigen Anbietern und digitaler Vermögensverwaltung.
- Rechtliche Risiken durch Klagen gegen überhöhte Gebühren und schlechte Produktauswahl.
- Reputationsverlust schädigt Markenimage und Vertrauen.
- Marktanteilsverlust besonders im jüngeren Kundensegment.
- Druck zur Anpassung des Produktangebots und Beratungsprozesses.
| Folge | Betroffene Banken | Beispiel |
|---|---|---|
| Kundenabwanderung | Deutsche Bank, Postbank, Commerzbank | Hohe Zahlen bei Wechsel zu Online-Brokern |
| Rechtliche Auseinandersetzungen | Volksbank, Sparkasse, KfW Bank | Klagen wegen überteuerter Fondsgebühren |
| Reputationsverluste | Unicredit Bank, Targobank | Negative Medienberichte |
| Marktanteilsverlust | ING-DiBa, DZ Bank | Verjüngung der Kundschaft bleibt aus |

Strategien für Anleger: Wie man sich vor schlechten Bankprodukten schützt
Angesichts der Risiken und Hintergründe ist es essentiell, als Anleger wachsam zu sein und seine Depots kritisch zu prüfen. Wer nicht blind auf die Beratung durch Banken wie Sparkasse, Unicredit Bank oder Deutsche Bank vertraut, kann erhebliche Verbesserungen bei den Renditen seiner Anlagen erzielen. Dabei helfen klare Kriterien, unabhängige Vergleiche und das bewusste Vermeiden von Interessenkonflikten.
Ein bewährter Ansatz ist es, verstärkt kostengünstige ETFs oder Indexfonds in das Portfolio zu integrieren, die in der Regel besser performen als viele bankeigene Produkte. Daneben empfiehlt sich eine regelmäßige Analyse des Portfolios, um den Anteil bankeigener Produkte zu überwachen und bei Bedarf zu reduzieren.
Liste wichtiger Maßnahmen zum Schutz vor schlechten Bankprodukten
- Vergleich mehrerer Anbieter vor einer Anlageentscheidung.
- Fragen zur Gebührenstruktur und transparenten Kosten stellen.
- Unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen, z.B. durch FinTechs oder Honorarberater.
- Regelmäßige Portfolioanalyse und Anpassung der Asset-Allokation.
- Bewusstes Investieren in kostengünstige ETFs und Indexfonds als Alternative.
| Maßnahme | Beschreibung | Erwarteter Nutzen |
|---|---|---|
| Vergleich mehrerer Anbieter | Analyse verschiedener Depots inkl. Gebühren und Produkte | Wahl des besten Angebots |
| Transparenzfragen | Detaillierte Klärung aller Gebühren und Kosten | Geringere Kosten und bessere Rendite |
| Unabhängige Beratung | Nutzung externe Berater oder digitale Vermögensverwalter | Objektive Produktempfehlungen |
| Portfolioanalyse | Regelmäßige Überprüfung der Produktqualität | Optimierung der Anlagen |
| Investition in ETFs | Kostengünstige, breit diversifizierte Indexprodukte | Verbesserte Rendite und geringere Risiken |
FAQ – Häufig gestellte Fragen rund um bankeigene Produkte und Interessenlagen
- Warum verkaufen Banken oft ihre eigenen Produkte?
Banken erzielen durch hauseigene Produkte doppelte Erträge und können diese leichter kontrollieren, was ihre Ertragslage verbessert. - Was sind die Nachteile für Anleger bei bankeigenen Fonds?
Häufig höhere Gebühren, geringere Diversifikation und damit verbunden niedrigere Renditen als bei unabhängigen Produkten. - Wie erkenne ich, ob mein Depot zu viele bankeigene Produkte enthält?
In der Depotaufstellung finden sich Angaben zur Produkt Herkunft. Ein Anteil von über 30% bankeigener Produkte sollte kritisch betrachtet werden. - Können unabhängige Finanzberater helfen, bessere Produkte zu finden?
Ja, unabhängige Berater und Honorarberater bieten oft objektive Einschätzungen ohne Interessenkonflikte. - Gibt es gesetzliche Regelungen zum Schutz vor Interessenkonflikten?
Ja, Richtlinien wie MiFID II und Urteile wie jenes des Bundesgerichts verlangen Transparenz und Weitergabe von Retrozessionen an Kunden.